Herzlich willkommen auf der Seite über
Idar-Oberstein. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von
91,58 km² Quadratkilometern. Die Einwohnerzahl von
Idar-Oberstein liegt momentan
bei ungefähr 28.423 (31. Dez. 2021) womit die durchschnittliche Einwohnerzahl pro Kilometer bei
310 liegt. Hier gilt das Autokennzeichen BIR.
Zu erreichen ist die Gemeinde auch über die Domain www.idar-oberstein.de.
Auf dieser Seite über Idar-Oberstein finden Sie nicht nur geschichtliche Informationen oder die Chronik von
Idar-Oberstein, sondern auch die von uns empfohlenen Unternehmen aus der
umliegenden Region.
Weitere Informationen finden Sie auch über
www.idar-oberstein.de. Erreichen können Sie
Idar-Oberstein über gängige Verkehrswege. Der
Gemeindeschlüssel lautet 07 1 34 045.
Die Gemeinde Idar-Oberstein liegt auf einer Höhe von
272 Metern über dem
Meeresspiegel.
Suchen Sie eine Arbeitsstelle, planen eine Umschulung oder einen Berufswechsel? In unserem Stellenmarkt finden auch Sie die passenden Stellenangebote (Stellenmarkt
Bad Kreuznach).
Auch für Sparfüchse empfehlen wir Ihnen Unternehmen und Angebote aus dem ganzen Landkreis und auch
Idar-Oberstein (Sonderangebote Bad Kreuznach).
Idar-Oberstein ist eine kreisangehörige Stadt im Landkreis
Birkenfeld, Rheinland-Pfalz. Die verbandsfreie Stadt ist das
Ergebnis umfassender Verwaltungs- und Strukturreformen der
Jahre 1933, 1969 und 1970. Die Edelstein- und Garnisonsstadt
ist mit knapp 30.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste
Kommune des Landkreises und ein Mittelzentrum. Seit 2016 trägt
die Kommune den Titel „Nationalparkstadt Idar-Oberstein“.


Geographische Lage
Idar-Oberstein liegt am südlichen
Rand des Hunsrücks beiderseits der Nahe. Größere Städte in der
näheren Umgebung sind Trier (ca. 50 Kilometer westlich), Bad
Kreuznach (ca. 30 Kilometer nordöstlich) und Kaiserslautern
(ca. 35 Kilometer südöstlich). Die Stadt liegt am Rande des
Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Die Wasserversorgung bezieht
die Stadt aus der Steinbachtalsperre.
GeschichteDie Stadt Idar-Oberstein ist eine
Kommune, die erst seit dem 1. Oktober 1933 besteht. Zuvor
entwickelten sich die einzelnen Stadtteile sehr
unterschiedlich.

 Altertum und Mittelalter
Oberstein
Altertum und Mittelalter
ObersteinDer Stadtteil Oberstein entwickelte
sich aus der reichsunmittelbaren Herrschaft Oberstein. Die
Herren vom Stein (Oberstein), erstmals 1075 erwähnt, hatten
ihren Sitz oberhalb der später errichteten Felsenkirche, auf
der Burg Bosselstein, welche bereits im 12. Jahrhundert
erwähnt wird und als „Altes Schloss“ bekannt ist. Der
Kernbereich der Herrschaft wurde begrenzt durch die Nahe, den
Idarbach, den Göttenbach und den Ringelbach. Mitte des 13.
Jahrhunderts spalteten sich die Obersteiner in die
verfeindeten Linien der „Herren von Oberstein“ (Burg
Bosselstein) und „von Daun-Oberstein“ (Schloss Oberstein).

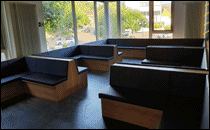
Erstere verließen schließlich die Gegend und letztere konnten
ihren Machtbereich erheblich, auch auf Gebiete südlich der
Nahe und den Idarbann, ausdehnen. Als Herrschaftssitz mit der
Burg und den Befestigungen – Reste der um 1410 angelegten
Stadtmauer sind heute noch „Im Gebück“ sichtbar – konnte
Oberstein einen städtischen Charakter entwickeln, ohne jedoch
über den rechtlichen Status eines Flecken hinauszukommen. 1682
wurden die Grafen von Leiningen-Heidesheim, 1766 die Grafen
von Limburg-Styrum Besitzer der Herrschaft Oberstein, die im
Wesentlichen auf das vorgenannte Kerngebiet zusammenschmolz,
nachdem der Idarbann im Jahr 1771 an die Hintere Grafschaft
Sponheim angegliedert wurde. 1776 wurden die Markgrafen von
Baden Besitzer der Herrschaft, nachdem die Hintere Grafschaft
Sponheim geteilt wurde.

 Idar
Idar
Die Besiedlung von Idar kann bis in früheste Zeit durch
Bodenfunde nachgewiesen werden. Der Ort Idar rechts des
Idarbachs gehörte mit den Orten Enzweiler, Algenrodt,
Mackenrodt, Hettenrodt, Hettstein, Obertiefenbach und
Kirschweiler zum Idarbann. Das Gebiet gehörte überwiegend den
Herren von Oberstein und teilt damit die Geschichte mit
Oberstein, doch hatten insbesondere in Tiefenbach und
Kirschweiler die Wild- und Rheingrafen sowie die Abtei Tholey
Güter und sonstige Rechte.

 Weitere Stadtteile
Weitere Stadtteile
Der Ort Tiefenstein entstand aus der Zusammenlegung der
Orte Tiefenbach und Hettstein im Jahr 1909. Die
Territorialgeschichte der Idarbann-Gemeinde entspricht der von
Idar und Oberstein. Tiefenbach wird in einer Urkunde von 1283
als Hof erwähnt; eine Erwähnung von 1051 kann nicht sicher dem
Ort zugeordnet werden. Hettstein wurde 1321 als Henzestein
bzw. Hezerten erwähnt und hatte unter anderem wildgräfliche
Untertanen als Bewohner.

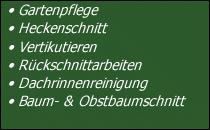
Das Dorf Algenrodt wird
erstmals sicher in einer obersteinischen Lehensurkunde von
1321 als Alekenrod erwähnt. 1324 wurde es von den Herren von
Oberstein an die Kyrburger Wild- und Rheingrafen verpfändet.
Im Übrigen teilt Algenrodt die Geschichte mit den anderen
Idarbann-Gemeinden.
Enzweiler kann Siedlungsspuren bis
in römische Zeit nachweisen. 1276 besaß die Abtei Tholey eine
Mühle bei Enzweiler. Der Ort selbst ist wohl im 14.
Jahrhundert entstanden und war stets Teil des Idarbanns.
Der nördlich der Nahe terrassenförmig auf einem steil zur
Nahe abfallenden Gelände gelegene Ort Georg-Weierbach geht
wahrscheinlich auf eine Kirchengründung des Mainzer
Erzbischofes Hatto im 10. Jahrhundert zurück. 1155 wird der
Ort im Zusammenhang mit den Herren von Wirebach (= Weierbach)
erwähnt. 1327 wurde der Ort, der kurzzeitig im Besitz der
Herren von Randeck war, größtenteils an die Wild- und
Rheingrafen verkauft und dem Amt Kyrburg zugeordnet. Die
Bezeichnung Georg-Weierbach entstammt dem Patrozinium der
Kirche.
Das 1271 erstmals urkundlich erwähnte
Göttschied gehörte gemeinsam mit Regulshausen, Gerach und
Hintertiefenbach zur Abtei Mettlach („Abteidörfer“). 1561
wurden diese Dörfer an die Hintere Grafschaft Sponheim
verkauft.
Hamerzwiller (= Hammerstein) wird 1438 im
Gültbuch der Grafschaft Sponheim erwähnt und befand sich
bereits 1269 in hintersponheimischem Besitz, als es als Lehen
an den Grafen von Schwarzenberg gegeben wurde.
Als
Ursprung des Orts Kirchenbollenbach wird eine Kirchengründung
des Mainzer Erzbischofs Williges nach 975 angesehen. Erstmals
urkundlich nachweisbar ist der Ort 1128 unter dem Namen
„Bolinbach“. Zunächst als Lehen der Herren von Schwarzenberg
von den Grafen von Zweibrücken belegt, kam der Ort 1595 an die
Kirner Wild- und Rheingrafen. Als eine regionale Besonderheit
ist hier zu nennen, dass im weiteren Verlauf eine katholische
Seitenlinie der überwiegend protestantischen Rheingrafen unter
dem Fürsten Johann Dominik von Salm-Kyrburg in
Kirchenbollenbach das Simultaneum einführte und eine neue
(katholische) Pfarrei gründete.
Als Grundstein des Orts
Mittelbollenbach gilt der 1283 als Besitz der Herren von
Oberstein im Bereich des Waldgebiets Winterhauch erwähnte Hof
Bollenbach. 1432 wurden die Herzöge von Lothringen mit Nah-
und Mittelbollenbach belehnt, was nach dem Erlöschen der
Obersteiner Linie wegen der komplizierten Erbfolge zu
erbitterten Auseinandersetzungen führte. Erst im Jahr 1778 kam
es zum Verzicht der Lothringer zu Gunsten von Kurtrier.
Bis 1667 entspricht die Geschichte Nahbollenbachs der von
Mittelbollenbach. Dann wurde Nahbollenbach von Lothringen als
Allodialbesitz von Oberstein anerkannt, verblieb aber seit
1682 als kurtrierisches Lehen bei der Herrschaft.
Das
Abteidorf Regulshausen gehörte zur Abtei Mettlach und wurde
1561 von dieser an die Hintere Grafschaft Sponheim verkauft.
Die älteste urkundliche Erwähnung ist aus dem Jahr 1491.
Als „Weygherbach“ ist Weierbach 1232 erstmals erwähnt und
gehörte zum vordersponheimischen Amt Naumburg. Die späteren
Besitzer der Vorderen Grafschaft Sponheim waren die Markgrafen
von Baden, wodurch der Ort auch unter dem Namen
Baden-Weierbach bekannt wurde. Die häufig benutzte Bezeichnung
Martin-Weierbach entstammt dem Patrozinium der Kirche.
Neuzeit
Französische Herrschaft
Nach Auflösung der alten Herrschaften führten ab 1794 die
neuen französischen Herren eine umfassende Neuorganisation der
territorialen (und sozialen) Struktur herbei. Der gesamte Raum
gehörte zum Arrondissement Birkenfeld im Département de la
Sarre und war vom 4. November 1797 nominell und nach den
Vereinbarungen beim Frieden von Lunéville ab dem 9. März 1801
offiziell bis 1814 französisches Staatsgebiet. Die Einführung
des Code civil, eine Justizreform und ganz besonders die
Abschaffung von Adel und Klerus mit dem damit verbundenen
Wegfall von Fron und anderen Lasten machten die französische
Herrschaft rasch populär. Die enorme Steuerbelastung und die
ständigen Aushebungen zu Gunsten der französischen Armee
drückten jedoch auf die Menschen der Region.
Preußen und OldenburgNach dem Ende der
napoleonischen Herrschaft wurde der Raum erneut neu
strukturiert. Auf der Grundlage des Artikels 25[6] der
Schlussakte zum Wiener Kongress kam der Nordteil des
Département de la Sarre im Juni 1815 zunächst an Preußen. In
Oberstein wurde ein preußisches Landratsamt errichtet. Da sich
Preußen im Pariser Frieden von 1815 verpflichtet hatte, aus
diesem Gebiet einen Bereich mit zusammen 69 000 Einwohnern an
den Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld (20 000 Seelen), den
Herzog von Oldenburg (20 000 Seelen) und andere kleine Fürsten
abzugeben und dieses im Artikel 49[7] der Schlussakte zum
Wiener Kongress festgelegt wurde, kam es zu einer weiteren
Aufteilung der Region.
Die südlich der Nahe gelegenen
Orte Hammerstein, Kirchenbollenbach, Mittelbollenbach,
Nahbollenbach und Martin-Weierbach sowie der Homerische Hof
kamen daher 1816 an das Fürstentum Lichtenberg der Herzöge von
Sachsen-Coburg-Saalfeld. Die Coburger Herzöge waren mit diesem
Zugewinn nicht zufrieden, wie auch die Einwohner des
Fürstentums Lichtenberg mit den Coburgern unzufrieden waren.
Das Gebiet wurde 1834 für zwei Millionen Taler von
Sachsen-Coburg und Gotha an Preußen verkauft und in den
Landkreis St. Wendel umgewandelt, aus dessen nicht in das
Saargebiet eingegliederten Teilen nach dem Ersten Weltkrieg
der Restkreis Sankt Wendel-Baumholder hervorging. Die Preußen
wurden ebenfalls nicht geliebt, weil sie teils mit
militärischer Macht die eigene Ordnung durchsetzten. Man trug
ihnen nach, dass sie u. a. auf coburgischen Hilferuf zum
Hambacher Fest im Mai 1832 eine Protestkundgebung in St.
Wendel, wo auch in napoleonischer Tradition ein Freiheitsbaum
gesetzt wurde, mit militärischer Gewalt beendeten.
Idar, Oberstein, Tiefenstein, Algenrodt, Enzweiler,
Georg-Weierbach, Göttschied und Regulshausen wurden am 16.
April 1817 Teil des neu geschaffenen oldenburgischen
Fürstentums Birkenfeld im Amt Oberstein mit den
Bürgermeistereien Herrstein, Oberstein und Fischbach. Die
französische Gesetzgebung blieb bestehen, doch erließ der
Herzog ein Staatsgrundgesetz, womit die Bevölkerung nicht
einverstanden war, weil sie lieber bei Preußen geblieben wäre.
Diese Fortsetzung der deutschen Kleinstaaterei wurde
insbesondere in Idar und Oberstein sehr kritisch gesehen, im
Gegensatz zu dem nun zur Residenzstadt aufgestiegenen
Birkenfeld. Die seinerzeit schon überregional bis
international ausgerichtete Schmuckindustrie und die bei aller
Provinzialität doch weltläufigen Edelsteinhändler empfanden
dieses, zumal nach der jahrelangen Zugehörigkeit zu Frankreich
mit der mondänen Metropole Paris und den dort getätigten guten
Geschäften, als Rückschritt und forderten z. T. energisch,
aber erfolglos, den erneuten Anschluss an Preußen. Dennoch
konnten sich die Oldenburger rasch bei der Bevölkerung beliebt
machen, weil sie eine uneigennützige Verwaltung installierten,
die unabhängige Rechtsprechung sicherstellten und vielfältige
Aktivitäten zu Gunsten der Bauern und der Wirtschaft
einleiteten. Ein geordnetes Schulsystem (1830 wurde in
Oberstein eine Bürgerschule eingerichtet) und der
vorübergehende Verzicht auf die Aushebung für den
Militärdienst unterstützten dieses positive Bild. Es wurden
Straßen ausgebaut und eine Fahrpost eingerichtet. Der Bau der
Nahe-Eisenbahn und die Inbetriebnahme der Strecke von Bad
Kreuznach nach Oberstein am 15. Dezember 1859 führten zu einem
weiteren wirtschaftlichen Aufschwung. 1865 wurden den Kommunen
Oberstein und Idar formell das Stadtrecht durch Oldenburg
verliehen.
Kaiserreich, Weimarer Republik und Drittes Reich
Mit der Reichsgründung 1871 gehörten die Gemeinden und
Städte dem Deutschen Kaiserreich an. Nach Ende des Ersten
Weltkriegs verzichtete der oldenburgische Großherzog Friedrich
August auf seinen Thron. Aus dem Fürstentum Birkenfeld wurde
der Landesteil Birkenfeld des Freistaats Oldenburg. Der
Landesteil Birkenfeld wurde am 4. Dezember 1918 wie das
gesamte Rheinland von französischen Truppen besetzt, die erst
zum 30. Juni 1930 wieder abzogen (siehe Alliierte
Rheinlandbesetzung). Nach dem Untergang des Kaiserreiches
blieben die Gemeinden Teil des nun in eine Republik
umgewandelten Deutschen Reiches.
Bei der
Oldenburgischen Landtagswahl am 17. Mai 1931 erreichte die
NSDAP über 37 Prozent der abgegebenen Stimmen, konnte jedoch
noch nicht die Regierung bilden. Nachdem die NSDAP zunächst
eine Toleranzerklärung für die bestehende Regierung abgegeben
hatte, forderte sie bald die Auflösung des Landtags. Da dieser
die Auflösung verweigerte, strengten die Nationalsozialisten
ein Volksbegehren an, das zu einem Volksentscheid führte, mit
dem am 17. April 1932 der oldenburgische Landtag aufgelöst
wurde. Es kam damit zu einer noch weitgehend freien Neuwahl
zum Oldenburger Landtag am 29. Mai 1932, die mit einem
Gesamtstimmenanteil von 48,38 Prozent zu einem Sieg der NSDAP
führte, die damit 24 von 46 Sitzen – eine absolute Mehrheit –
erlangte. In der Stadt Idar erreichten die Nationalsozialisten
über 70 Prozent der abgegebenen Stimmen. Damit konnten sie
bereits vor der offiziellen Machtübernahme im Deutschen Reich
im Oldenburgischen mit Billigung der Deutschnationalen
Volkspartei, die über zwei Sitze verfügte, regieren. Eine der
ersten Initiativen der neuen Machthaber war der Erlass einer
Verwaltungsreform für das Land Oldenburg, dem am 27. April
1933 das ähnliche Gesetz zur Vereinfachung und Verbilligung
der Verwaltung für den Landesteil Birkenfeld folgte. Damit
wurden insgesamt 18 ehemals selbständige Orte zusammengelegt,
so auch die bis dahin selbständigen Städte Idar und Oberstein
mit den Gemeinden Algenrodt und Tiefenstein zur neuen Stadt
Idar-Oberstein. Das Gesetz wurde innerhalb weniger Wochen ohne
weitere Diskussion oder Beteiligung, unter Ausschluss der
Öffentlichkeit und auch gegen den Willen der nicht gefragten
Gemeinden wie Herrstein und Oberwörresbach, Rötsweiler und
Nockenthal, Hoppstädten und Weiersbach durchgesetzt. Die
Nationalsozialisten unter dem Kreisleiter Herbert Wild aus
Idar besetzten bis zum Ende des Nazireichs alle wesentlichen
öffentlichen Positionen. Am 1. Oktober 1933 wurden die Städte
Oberstein und Idar zur Stadt Idar-Oberstein zusammengelegt.
1937 wurde auf der Grundlage des Groß-Hamburg-Gesetzes der
oldenburgische Landesteil Birkenfeld aufgelöst und mit dem
Restkreis Sankt Wendel-Baumholder in den preußischen Landkreis
Birkenfeld überführt, dem alle Gemeinden der heutigen Stadt
Idar-Oberstein angehörten. Im Zuge der Remilitarisierung des
Rheinlandes wurde Idar-Oberstein ab 1938 deutsche
Garnisonsstadt.
Bundesrepublik Deutschland
Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte das heutige Stadtgebiet
zum Gebiet der Französischen Besatzungszone und der Landkreis
Birkenfeld wurde ein Teil des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Im
Zuge der rheinland-pfälzischen Kommunalgebietsreform wurden
neun Umlandgemeinden eingemeindet. Am 7. Juni 1969 wurden die
Gemeinden Enzweiler, Göttschied, Hammerstein und Regulshausen
eingemeindet, am 7. November 1970 erfolgte die Eingemeindung
von Georg-Weierbach, Kirchenbollenbach, Mittelbollenbach,
Nahbollenbach und Weierbach.[9] Dieser Gebietsreform gingen
umfangreiche, teilweise im Verborgenen geführte Gespräche des
damaligen Idar-Obersteiner Oberbürgermeisters Wittmann mit
Verhandlungsangeboten an insgesamt 22 Gemeinden des Umlands
voraus („Umlandgespräche“). Einer der Gründe war die damals
erkennbare Abwanderung von Idar-Obersteiner Bürgern in die
Umlandgemeinden, die umfangreiche Neubaugebiete bereitstellten
– unter anderem Göttschied, Rötsweiler-Nockenthal und
Kirschweiler –, während im Stadtgebiet selbst auf Grund der
problematischen Geländestruktur derartige Neubauflächen kaum
vorhanden waren. Ebenso mangelte es im Stadtgebiet an
geeigneten Flächen für Industrieansiedlungen. Überraschend war
das ohne vorhergehende Idar-Obersteiner Initiative geäußerte
Beitrittsbegehren des Orts Weierbach. Dieser grenzte
seinerzeit noch nicht an die Stadt Idar-Oberstein an und war
als Nukleus für eine neue Großgemeinde oder Stadt vorgesehen,
die unter anderem aus den dann zusammenzulegenden Gemeinden
Weierbach, Fischbach, Georg-Weierbach und Bollenbach bestehen
sollte.
Am 1. April 1960 wurde die Stadt Idar-Oberstein
auf ihren Antrag hin von der Landesregierung zur Großen
kreisangehörigen Stadt erklärt. Mit Ausnahme von
Georg-Weierbach waren in den Orten bzw. den Gemeinderäten die
Mehrheiten zu Gunsten der Auflösung der jeweiligen Gemeinde
und des anschließenden Beitritts zur Stadt Idar-Oberstein sehr
deutlich. Trotzdem kam es insbesondere im ehemaligen Amt
Weierbach, das nun seiner Kerngemeinden beraubt war, zu
erbitterten Diskussionen und auch verwaltungsgerichtlichen
Auseinandersetzungen. Im April 1970 legte das Amt Weierbach
Verfassungsbeschwerde beim rheinland-pfälzischen
Verfassungsgerichtshof ein, der am 8. Juli 1970 feststellte,
dass das Landesgesetz über die Verwaltungsvereinfachung in
Rheinland-Pfalz in Teilen verfassungswidrig sei. Das
Selbstverwaltungsrecht des Amts Weierbach sei durch das Gesetz
beeinträchtigt und die Lebensfähigkeit des Gemeindeverbands
gefährdet. Damit wurden Weierbach, Georg-Weierbach, Nah-,
Mittel- und Kirchenbollenbach mit sofortiger Wirkung wieder
ausgemeindet und selbständig. Nach erbitterten
Auseinandersetzungen zwischen der Stadt Idar-Oberstein
gemeinsam mit den Fusionsbefürwortern einerseits und dem Amt
Weierbach und den Fusionsgegnern andererseits, die in
Demonstrationen, Versammlungen oder Leserbriefduellen ihre
Überzeugungen vertraten, fand Anfang September 1970 eine
Bürgerbefragung mit einer Abstimmung im Amt Weierbach statt.
Das Ergebnis entsprach dem vorherigen Stand: die zuvor nach
Gerichtsbeschluss abgetrennten Gemeinden stimmten mit fast 80
Prozent der abgegebenen Stimmen für den Anschluss an
Idar-Oberstein, während die übrigen Gemeinden des Amts
Weierbach – Sien, Sienhachenbach, Schmidthachenbach,
Fischbach, Zaubach und Dickesbach – mit einer Quote von rund
95 Prozent für den Erhalt des Amts Weierbach votierten.
Mit dieser Stadterweiterung hatten sich die Schwerpunkte
im Kreis Birkenfeld wesentlich verschoben. Idar-Oberstein
konnte sich als Mittelzentrum weiter entwickeln: Die
Schullandschaft wurde erweitert (Realschule,
Heinzenwies-Gymnasium), Neubaugebiete konnten ausgewiesen
werden (besonders in Göttschied, Regulshausen und Weierbach),
es war Raum für ein neues Krankenhausgebäude vorhanden und
neue Flächen für Industrie- und Gewerbeansiedlung standen zur
Verfügung (zum Beispiel Globus-Handelshof in Weierbach und das
Einkaufszentrum EKZ in der Vollmersbach).
Da
Idar-Oberstein nicht nur über eine gute
Allgemeininfrastruktur, sondern nach der Inbetriebnahme der
Steinbachtalsperre über mehr als ausreichende Wasservorräte
verfügte, war die Beitrittsoption für viele weitere Gemeinden
attraktiv. Auf Initiative des Oberbürgermeisters Wittmann, der
ein Gutachten eines Osnabrücker Planungsbüros zur Untersuchung
des Verhältnisses der Stadt zu 25 weiteren Nachbargemeinden
erstellen ließ, wurde in einem Stadtratsbeschluss die
„unbedingte Eingemeindung“ der Gemeinden Fischbach,
Dickesbach, Zaubach, Mittelreidenbach, Oberreidenbach,
Schmidthachenbach, Sienhachenbach, Sien, Hintertiefenbach und
Vollmersbach gefordert. Die Gemeinden Rötsweiler-Nockenthal,
Siesbach, Gerach, Veitsrodt, Kirschweiler, Hettenrodt und
Mackenrodt sollten ein Eingliederungsangebot erhalten.
Daraufhin wurde die Kreisverwaltung in Birkenfeld aktiv, und
es kam zu einem Kreistagsbeschluss, in dem die als
rücksichtslos empfundene Eingemeindungspolitik der Stadt
Idar-Oberstein verurteilt wurde. Da sich mittlerweile bei den
Beitrittsgemeinden und auch der Stadt Idar-Oberstein selbst
eine gewisse Ernüchterung hinsichtlich der Eingemeindungen
eingestellt hatte, verliefen alle weiteren Initiativen im Sand
bzw. wurden eingestellt.
Am 1. Januar 1994 wurde der
den Truppenübungsplatz umfassende Gutsbezirk Baumholder
aufgelöst, wobei mehrere Flurstücke, auf denen die Gemarkungen
abgesiedelter Gemeinden lagen, auch an die Stadt
Idar-Oberstein fielen, die ihre Stadtfläche so vergrößerte.
WirtschaftsgeschichteDie Orte
Idar und Oberstein entwickelten sich ab der Mitte des 19.
Jahrhunderts neben Pforzheim, Hanau und Schwäbisch Gmünd zu
einem der vier wichtigsten Schmuckzentren Deutschlands.
Aufgrund der natürlichen Vorkommen an Achaten, Jaspis und
anderen Edelsteinen waren in Idar und Oberstein schon früh die
Berufe des Achatschleifers und später auch des Achatbohrers
entstanden. Als Folge siedelten sich um 1660 Goldschmiede in
der Region an, denn durch das Fassen der Achatwaren konnten
deren Absatzmöglichkeiten gesteigert werden. Die Goldschmiede
siedelten sich hauptsächlich am Obersteiner Naheufer an, die
Achatschleifer hingegen am Idarbach wegen der besseren
Wasserverhältnisse zum Betreiben der Schleifsteine. Da die
Nahe regelmäßig Hochwasser führte, hätte sie die Schleifmühlen
überschwemmt. Für die Goldschmiede war die Nahe jedoch ideal,
da sie für viele Arbeitsvorgänge Wasser brauchten. Deshalb
lagen alle frühen Fabrikgründungen am Obersteiner Naheufer.
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts erschöpften sich die
regionalen Achatvorkommen. In Idar verarbeitete man von da an
brasilianischen Achat, in Oberstein fand eine Entwicklung zur
reinen Metallwarenherstellung statt, und das
Goldschmiedehandwerk emanzipierte sich von der
Achatschleiferei. Dies führte in Oberstein Ende des 19.
Jahrhunderts zur Gründung zahlreicher Uhrkettenfabriken, die
zu einem weltweit bedeutenden Industriezweig wurden. Mit dem
Aufkommen der Armbanduhr während des Ersten Weltkriegs wurde
die Produktion mehr und mehr auf Modeschmuck umgestellt. Die
großen Namen waren z. B. Jakob Bengel, Klein & Quenzer, Ziemer
& Söhne, Carl August Haupt, Gebrüder Stern, Gottlieb & Wagner,
Carl Maurer Sohn, Walter Fischer, Ernst Schindler –
Prägeanstalt – u. v. m. Mit dem Aufkommen verschärfter
Umweltauflagen und der Konkurrenz aus Billiglohnländern in den
1970er Jahren wurde die Lage für die Modeschmuckfabriken immer
schwieriger. Doch noch heute gibt es in Idar-Oberstein einige
Schmuckfabriken aus der Gründerzeit. Im Industriedenkmal Jakob
Bengel hat sich eine Schmuckfabrik im Originalzustand
erhalten, die zu besichtigen ist. Der Stadtteil Idar war und
ist teilweise noch heute der Welthandelsplatz für Edelsteine
neben Antwerpen und Amsterdam, deren Schwerpunkt jedoch im
Diamantenhandel liegt. In der Blütezeit waren für die Idarer
Diamantschleifereien rund 7000 Diamantschleifer beschäftigt
sowie etliche Tausend Achat- und Schmucksteinschleifer.
